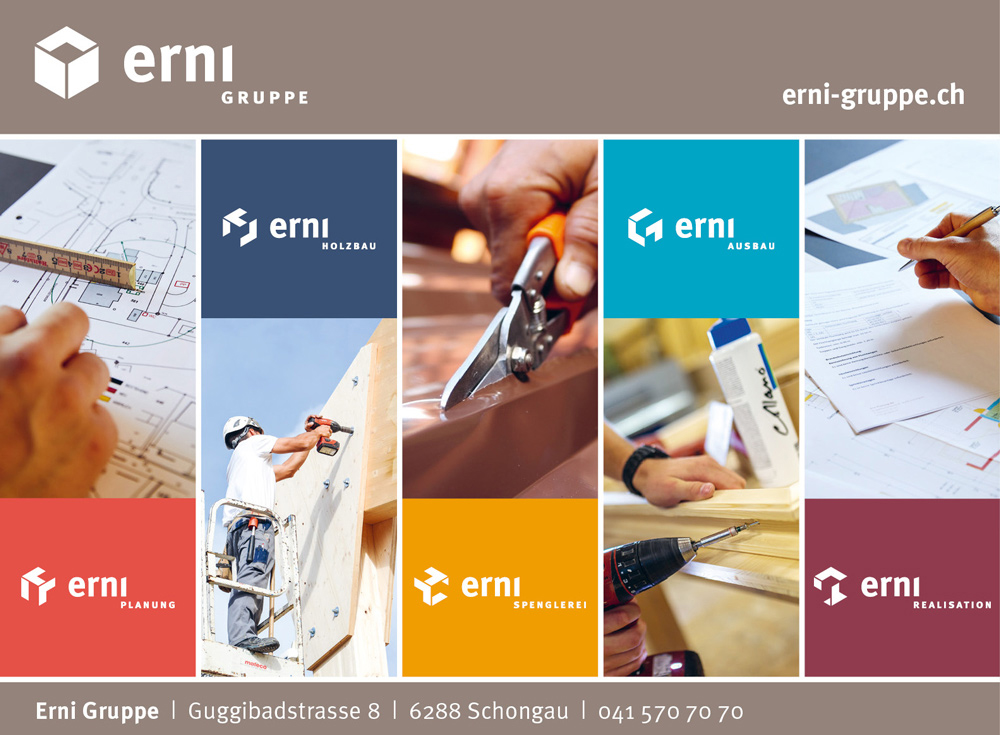Artenreiche Blumenwiesen – mager statt fett
- Text: Ernst Hofmann, Unterkulm
- Bild: Andreas Hoja auf Pixabay
- Urheber-/Nutzungsrechte: Link öffnen
Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst ca. 25% der Schweiz. Auf fast 60% dieser Nutzfläche wachsen heute Wiesen und Weiden. Sie prägen das Bild der Schweiz. Entstanden sind sie durch den rodenden Menschen, der für sich und sein Vieh Wiesen, Weiden und Äcker schuf. Zwischen Boden, Pflanzen und Tieren hat sich über Jahrhunderte ein einzigartiges Beziehungsnetz entwickelt. Kein anderer Lebensraum birgt so viel Artenvielfalt pro Quadratmeter. Ohne landwirtschaftliche Nutzung würden Wiesen und Weiden wieder verbuschen und zu Wald werden.
Es gibt viele verschiedene Wiesentypen. Bedeutsam sind die farbenfrohen, artenreichen Blumenwiesen für die Biodiversität, nämlich Fromental-, Trocken-, Feucht- und Bergwiesen. Ob eine Wiese farbenfroh und artenreich oder grün und eintönig ist, hängt hauptsächlich von drei Faktoren ab: dem Boden, dem Klima und der Bewirtschaftung. Klima und Boden geben die mögliche Artenvielfalt vor. Wieweit dies realisiert wird, hängt von der Art der Bewirtschaftung der Wiese ab. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts dominierte die klassische Heuwiese (Fromentalwiese), die häufigste Blumenwiese der Schweiz. Der Begriff Fromentalwiese stammt von der vorherrschenden Grasart Fromental (Glatthafer). Sie galt vor der Einführung von Kunstdünger und leistungsstarken Mähgeräten als die eigentliche «Fettwiese», die zur Produktion von Tierfutter genutzt wurde. Am vielfältigsten gedeiht sie an sonnigen Standorten, bei wenig Humus. Angepasste Spezialisten der Pflanzen- und Tierwelt übernehmen hier die Hoheit des Überlebens. Die Heuwiese wurde im Hochsommer durch einen Heuschnitt und im Spätsommer durch einen Emdschnitt mit Sense oder Balkenmäher gemäht. Eine Mistbeigabe oder Herbstweide mit Vieh war die Regel.
Noch artenreicher zeigen sich die trockenen Magerwiesen. Sie gehören zu den artenreichsten Lebensräumen in der Schweiz, sind aber heute zur Seltenheit geworden. Sie entstehen auf nährstoffarmen, mageren Böden, die vor allem wenig Stickstoff enthalten. Über 50 Pflanzenarten können pro Are Wiesenfläche vorkommen. Dominante Grasart ist die Aufrechte Trespe. Magerwiesen werden weder gedüngt noch beweidet. Zudem findet ein Grasschnitt erst im Juni, Juli statt, nach dem die Pflanzen Samen gebildet und die meisten Insekten die nächste Generation entwickelt haben. Die blütenreichen Magerwiesen sind für zahlreiche Insekten, wie Grillen, Heuschrecken, Schmetterlinge, Käfer und Ameisen optimale Nahrungs- und Lebensgrundlage. Der Boden ist dicht besiedelt von Würmern und anderen Kleintieren. Insbesondere die Vielzahl der Bakterien und Pilze in der Erde ist für die Pflanzen von enormer Bedeutung, da sie vielfach in gegenseitiger, kooperierender Lebensgemeinschaft (Symbiose) mit den Pflanzen leben.
Die heutigen «Fettwiesen» sind aufgrund der grösseren Nährstoffzufuhr durch Gülle und Kunstdünger Intensivwiesen und deshalb viel artenärmer durch die Dominanz von nährstoffliebenden Generalisten wie Löwenzahn, Hahnenfuss und Sauerampfer. Dafür ist der Ertrag mit vier bis sechs Grasschnitten viel höher. Als Folge gleichen die Flächen zunehmend einem einheitlich grünen Teppich. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten kommen die artenreichen Wiesen immer stärker unter Druck und verschwinden fast gänzlich. Noch 1950 war 95% des Wieslandes artenreich. Heute gibt es kaum noch 5% artenreiche Blumenwiesen und weniger als 1% gelten als artenreiche Magerwiesen. Darunter leidet nicht nur die Vielfalt der Pflanzen, sondern auch die Vielfalt der nur auf besondere Pflanzen spezialisierten Insekten, insbesondere Schmetterlinge.
Anzeige
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!