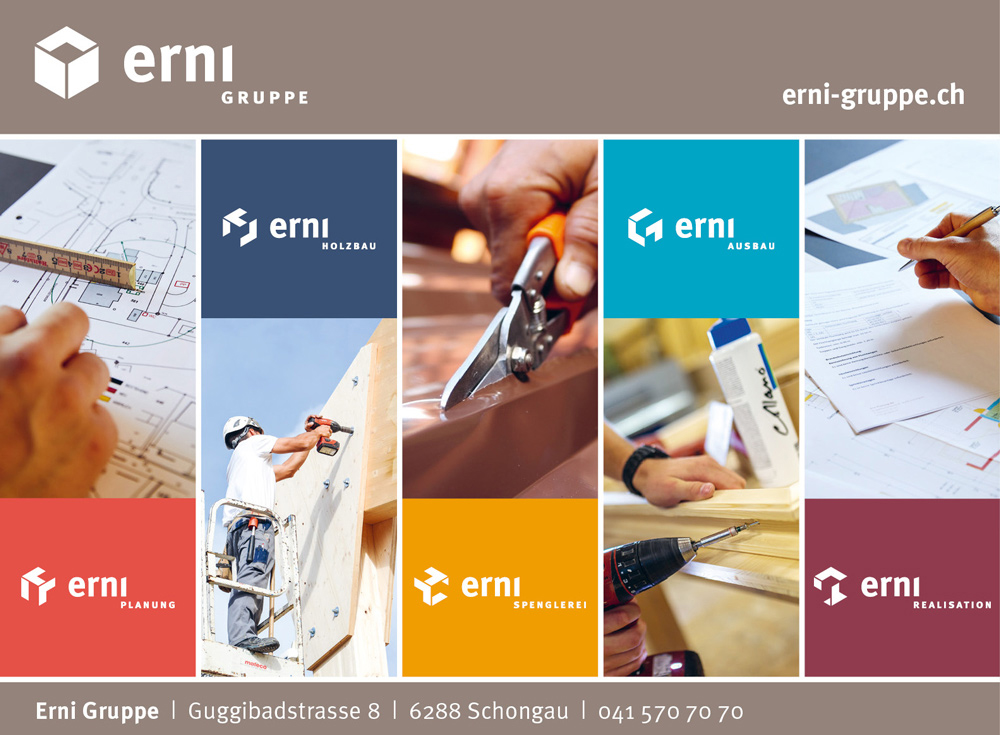Der Buchfink – ungleiches Paar und eheloses Männchen im Winter
- Text: Ernst Hofmann, Unterkulm
- Bild: Ernst Hofmann und sharkolot auf Pixabay.com
- Urheber-/Nutzungsrechte: Link öffnen
Nicht der Hausspatz ist die häufigste Vogelart in der Schweiz, sondern der Buchfink. Er kommt fast überall vor, denn er ist nicht besonders wählerisch. Wo eine Gruppe Bäume wächst, die er zum Singen und für den Nestbau benützen kann, ist er zu Hause.
Beim Buchfinken ist das Zugverhalten sehr geschlechtsspezifisch. Es sind vorwiegend die Weibchen, die uns im Herbst Richtung Südwesten in wärmere Gebiete zur Überwinterung verlassen. So kann man feststellen, dass in der Winterzeit die Männchen als Strohwitwer hier bleiben. Erkennen kann man sie am auffälligen «Prachtkleid» mit weinroter Kehle, Brust und Bauch im Gegensatz zum Weibchen, das diese Partien unauffälliger beigegrau zeigt. Man nennt dies Geschlechtsdimorphismus (ungleiche geschlechtliche Erscheinung). Es stellen sich hier zwei Fragen: Warum zieht vorwiegend das Weibchen in den Süden und warum sind die Geschlechter ungleich ausgestattet?
Zur ersten Frage: Kurz nach der Rückkehr im Frühling müssen die Weibchen schon bereit sein, Eier zu legen. Die Weibchen brauchen im Winter mehr Energie. Ihr Körper muss für die rasche Bildung der Eier Proteine, also Eiweisse, zur Verfügung haben, und zwar viel davon. Denn ein volles Gelege mit vier bis sechs Eiern kann ein Drittel des Körpergewichts ausmachen. Diese Baustoffe für den Aufbau von Muskeln und Skelett der Küken finden sie nur im Süden im Winterquartier in ausreichender Menge, nämlich über die reichlich verfügbare Insektennahrung. Die Männchen haben mittels Körner- und Samennahrung im Winter genügend Energie, da diese Nahrungsmittel vorwiegend Kohlenhydrate und Fette und damit Kraft- und Reservestoffe enthalten. So investieren sie die Nahrungsreserven in ein prachtvolles Federkleid und Werbegesang. Bei der Balz wollen sie den Weibchen imponieren, denn nur die kräftigsten, lautesten und schönsten werden von den Damen gewählt. Bei den meisten Singvögeln gilt Damenwahl.
Zur zweiten Frage: Warum sind die Geschlechter verschieden in der Erscheinungsform? Das sorgfältig, ausschliesslich vom Weibchen gebaute, dickwandige Napfnest besteht aus Halmen, Moosen und Flechten und ist im Innern mit Haaren und Federn gepolstert. Das Nest wird meistens in einer Höhe von zwei bis zehn Metern auf Sträuchern oder in Bäumen in einer Astgabel gebaut und ist durch die Moose und Flechten gut getarnt. Die Brutdauer beträgt dreizehn bis vierzehn Tage. Es brütet allein das Weibchen, das mit der Brut gewöhnlich nach der Ablage des vorletzten Eis beginnt. Damit wird verständlich, weshalb das Weibchen zum Schutz der Brut unauffällig getarnt sein muss. Nach dem Schlüpfen werden die Jungen von beiden Altvögeln gefüttert, wobei das Weibchen aber einen grösseren Anteil an der Versorgung der Jungvögel hat.
Noch deutlicher ist der Geschlechtsunterschied bei den Stockenten. Da ist das Männchen mit einem blaugrün schillernden Prachtkleid, das Weibchen nur braun gesprenkelt in einem Tarnkleid ausgestattet. Der Erpel kümmert sich nach der Paarungszeit überhaupt nicht um die Familie und verlässt das Weibchen umgehend. Bei den Vögeln gilt: Je unterschiedlicher die Paare in ihrem Aussehen sind, desto unterschiedlicher ist ihr Verhalten bei der Brutpflege. Sind beide auffällig (z. B. Meisen) oder getarnt (z. B. Spatz), so teilen sich die Partner die Arbeit bei der Brutpflege. Auffällige Paare brüten in einer Nisthöhle, getarnte Paare in einem offenen Nest.
Anzeige
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!