Das Beizensterben
Hätten Sie's gewusst?
… oder «Wenn’s kei Schpunte meh gäb.»
 (Bild: Bernd Hildebrandt auf Pixabay)
(Bild: Bernd Hildebrandt auf Pixabay)

Manchmal lohnt es sich, nicht allzu fest in die Ferne zu schweifen und auch mal einen Blick ins Dorfheftli-Archiv zu werfen. Insbesondere die Schwiizerdüütsch-Artikel des 2018 leider verstorbenen Franz «Feusi» Feuerhuber bringen einen zum Schmunzeln, Nachdenken und manchmal auch herzhaft zum Lachen.
Eine weitere dieser Perlen haben wir für Sie herausgepickt:
Wenn’s kei Schpunte meh gäb
«Spunte» kommt vom Spundloch des Weins, Biers oder Mostfasses. Die «Spünten» sind die oberen Verschlusszapfen der gefüllten Fässer, die durften nicht zu fest sitzen und mussten manchmal losgeklopft werden, damit einerseits der Most nicht zu sauer wurde und das Fass sprengte und andererseits überhaupt etwas aus dem Fass fliessen konnte. In der «Schpunte» wurden die Getränke also direkt aus dem Fass ausgeschenkt.
Pinte
Das «Pintli» oder die «Pinte» ist ein kleineres (höchstens einen Liter fassendes), kannenförmiges Gefäss, meistens aus Blech und im Normalfall mit einem Henkel und einem Deckel versehen. Entsprechend ist die «Pinte» das Wirtshaus, in dem per Gesetz nur Getränke ausgeschenkt werden durften, und die hatten wahrscheinlich nur «Blächtassli», da ging sicher weniger kaputt.
Beiz
Die «Beiz» hat zwei Hintergründe. Einerseits mit dem Ursprung aus dem hebräischen «bayit», was ganz einfach Haus bedeutet, und zum anderen das Beizen, Einlegen in Essig oder auch Milch von Fleisch, um es damit – das ist tatsächlich der Ursprung – beissbar zu machen. Beizen ist aber auch ein Arbeitsschritt bei der Herstellung von Leder, sehr geschmacksintensiv. Ich hoffe, dass nicht die Gerüche in der Gerberei zum Begriff «Beiz» führten, sondern eher das Haus, in welchem Fleisch beissbar gemacht wird.
Chnelle
Der Ursprung liegt im Wort Knall, «knelle oder chnelle». Damit war früher das geräuschvolle (knallende) Fressen gemeint, z. B. wenn die Wildsau die Eicheln «chnellt» im Sinn von laut knackend öffnet. Wenn der Hund nach einem schnappt, auch das nennt man «chneue», wahrscheinlich wenn die Knochen brechen. Ob dies der Grund ist, dass «chnelle» eine frühere Bezeichnung fürs Fluchen war, weiss ich wirklich nicht, aber als Bezeichnung für ein Wirtshaus ist «Chnelle» somit nicht wirklich nett – der Ort, an dem geknallt und geflucht wird.
D’ Lampe fülle
Der Begriff Lampe entstand aus dem früherem «Ampele», die von der Decke «lampet», eben hängt. «D’ Ampele lampet vo de Dechi», kurz Lampe, irgendwie sogar logisch, oder? Bis in die 50er-Jahre hinein wurden noch Öllampen verwendet und diese Lampen mussten abends vor dem Anzünden mit frischem Öl gefüllt werden. Nun wurde es Usus, wenn die Lampe gefüllt war und brannte, ein Gläschen zu Ehren der Lampe zu nehmen, und ich befürchte, es wurde öfters eben nicht nur die Lampe mehrmals gefüllt.
Guet, d’Lampe fülle isch vellicht nümme ganz ziitgemäss, vellicht einzig no inere Schpelunke, was us ’em latinische chunnt und ganz eifach en Höhli bedüütet, wär doch no schpeziell, wenn jede mit sim Ölpintli i de Schpunte z’erscht d’ Lampe füllt, bevor mer d’ Lampe füllt …
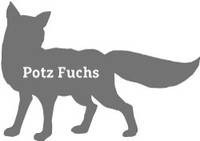
… das hani wörkli ned gwösst!
Anzeige
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!









