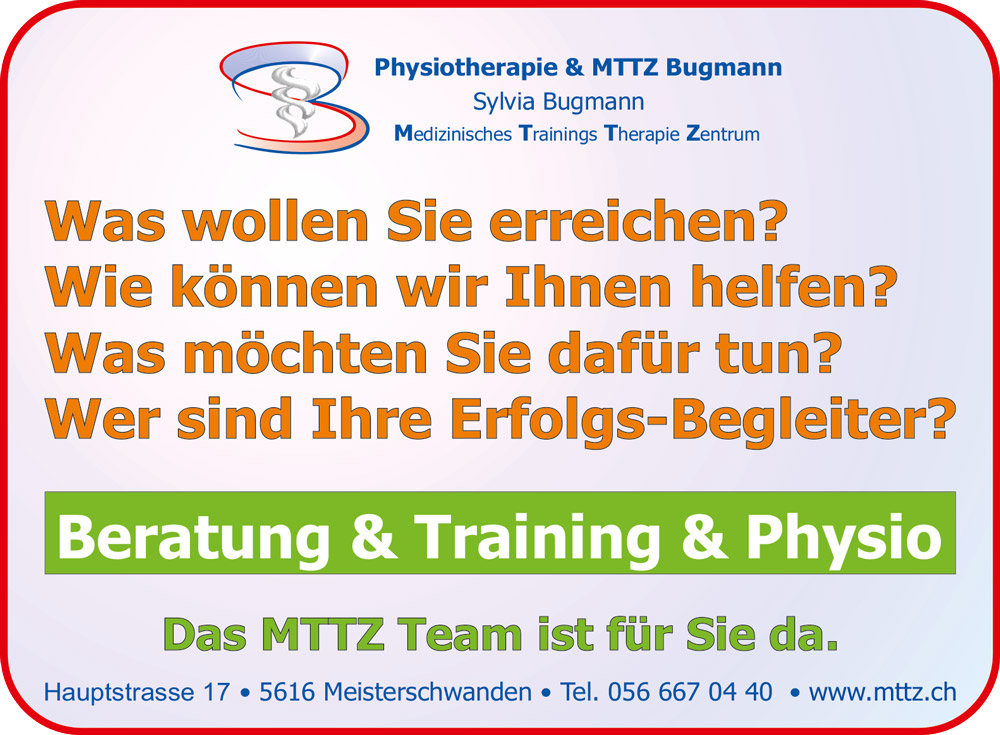Die Gehirnerschütterung
- Bild: Alexa auf Pixabay
- Urheber-/Nutzungsrechte: Link öffnen
Medizinisch ausgedrückt handelt es sich bei einer Gehirnerschütterung um ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma. Das heisst, es gibt auch mittlere und schwere Schädel-Hirn-Verletzungen. Im Gegensatz zu diesen kommt es bei einem leichten Schädelhirntrauma in den meisten Fällen zu einer völligen Wiederherstellung der Hirnfunktion.
Eine Gehirnerschütterung entsteht z.B. durch einen Schlag auf den Kopf, durch einen Sturz oder ähnlichen Unfall. Dabei prallt das Gehirn, das sich im Schädel in Flüssigkeit bewegt, auf der Seite des Anpralls gegen den Schädel. Auf der gegenüberliegenden Seite kommt es entsprechend zu einer Dehnung des Hirngewebes. Dadurch kommt es zu einer kurzzeitigen Funktionsbeeinträchtigung des Gehirns mit den Folgen von kurzer Bewusstlosigkeit, Gedächtnisverlust, Kopfschmerzen oder Übelkeit, eventuell mit Erbrechen.
Jeder Patient mit dem Hinweis auf eine Gehirnerschütterung muss ärztlich untersucht werden. Hier werden allgemeine Hirnleistungen oder auch Reflexe geprüft, die dem Arzt Auskunft über etwaige eingetretene Schädigungen geben. Zusätzlich kann eine Computertomografie notwendig sein, sollten sich manche Tests als nicht normal herausstellen. Der Patient sollte mindestens 24 Stunden im Spital beobachtet werden. Dafür ist es notwendig, dass regelmässig und in gewissen Abständen Hirnleistung und Reflexe überprüft werden, was nachts für die Patienten teilweise auch unangenehm und belastend sein kann. Es gilt jedoch frühzeitig eine Änderung zu erkennen und folgerichtig Massnahmen wie eine Computertomografie oder die Hinzuziehung eines Neurochirurgen zu veranlassen.
In den meisten Fällen heilt eine Gehirnerschütterung folgenlos ab. Zustände wie Konzentrationsschwäche, leichte Kopfschmerzen, Gedächtniseinschränkungen oder unscharfes Sehen können noch bis zu mehreren Wochen beobachtet werden. Nach einer Gehirnerschütterung sollte man in der ersten Woche Anstrengung vermeiden, auch Fernsehen oder Lesen. Danach sollte abhängig vom Befinden die Aktivität wieder gesteigert werden. Nicht zu viel und nicht zu wenig Aktivität heisst die Devise.
Dr. Michael Kettenring
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!